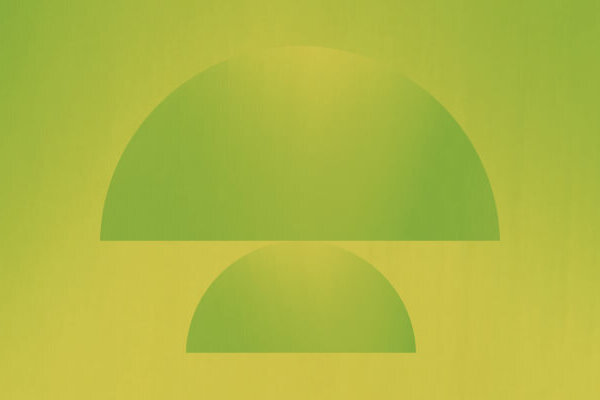
Achtsame Sprache – Kommunikation ohne Reparaturbetrieb
Achtsame Sprache schafft Klarheit ohne Verletzung und macht Konflikte lösbar. Sie stärkt Präsenz, Sicherheit und Kooperation – ein wirksames Führungsinstrument.
Mehr erfahren„Kirstens Konfekt“ – Exklusive Insights als Newsletter abonnieren

Wenige Einzelfaktoren können einen so entscheidenden Einfluss auf den Unternehmens- oder Projekterfolg haben wie die Kommunikation. Umso erstaunlicher ist es, dass diese Qualität bei so vielen Führungskräften nicht oder nicht ausreichend ausgeprägt ist. Wie oft hat man es schon erlebt, dass ein Meeting, ein Projekt oder gar eine ganze Unternehmung aufgrund vorgeschobener, vermeintlich sachlicher Differenzen scheitern musste, obwohl eigentlich andere, tieferliegende Beweggründe für unkooperative Verhaltensweisen und damit für das Scheitern von Vorhaben verantwortlich waren?
Auch die Zahlen sprechen hier eine deutliche Sprache. Laut den Chaos Studies der Standish Group (2009) verfehlen rund 50% aller Projektvorhaben ihr Ziel allein aufgrund zwischenmenschlicher Probleme. Das Gallup-Institut bezifferte 2016 den Anteil der sich dem Unternehmen verbunden fühlenden Mitarbeiter:innen mit ca. 15%. Der große Rest macht demnach Dienst nach Vorschrift oder hat bereits innerlich gekündigt. Stress, Mobbing und Burn-Out sind die beobachtbaren Symptome dieser anhaltenden betrieblichen Großwetterlage.
Als Reaktion auf ähnlich vernichtende, interne Umfragewerte oder steigende Krankheitstage werden diverse Ansätze ausprobiert – Yoga in der Mittagspause, Team-Building Offsites oder neue Projektmanagement-Tools. Doch die grundlegendste aller Qualitäten kommt dabei häufig zu kurz: die Kommunikation.

Auf die angemessene Kommunikation kommt es an!
Die Vorteile einer reflektierten Kommunikation liegen auf der Hand. Sie ermöglicht es uns, emotional schwierige Situationen zu meistern. Durch das Erkennen der zugrundeliegenden Muster und Treiber einer Reaktion bei uns selbst, können wir nicht nur zur Konstruktivität einer Diskussion beitragen, sondern auch die an uns gerichtete Kritik oder gar Vorwürfe analysieren und nutzen – für uns und unser Gegenüber.
Im Gegensatz zum üblichen hierarchie- oder karrieregetriebenen Machtkampf, dem Konzern-„PowerPlay“, führt eine Kommunikation, die die Verletzung und Schädigung anderer vermeidet, zu Klarheit und Verständnis der Sachlage auf beiden Seiten eines verbalen Austauschs. Ganz im Sinne der Botschaft „Ahisma“ von Mahatma Ghandi, die aus dem Sanskrit übersetzt so viel wie „GewaltFrei“ bedeutet, geht es um eine Lebenshaltung. Eine Haltung, die ein Abstandnehmen von feindseligen Gedanken ebenso mit einschließt, wie eben auch einen Verzicht auf eine Sprache, die andere für die eigenen Gefühle verantwortlich macht und damit Konflikte anstachelt.

Gewaltfreie Kommunikation – die Merkmale einer achtsamen Sprache
Um die gewaltfreie Kommunikation zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf ihre Merkmale. Im Rampenlicht steht dabei die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken zu können, ohne andere zu beschuldigen und zu bewerten. Das hilft nicht nur der eigenen psychischen Gesundheit, sondern trägt den wesentlichen Kern eines achtsamen Miteinanders in sich. Denn es ist die Bewertung der Dinge, die es uns schwer macht, objektiv, fair und empfänglich zu bleiben. Nicht umsonst fokussieren neue Arbeitsformen wie „New Work“ oder „Agile“ die Achtsamkeit als eine Schlüsselkomponente der persönlichen Entwicklungsdimension.
Die Achtsamkeit ermöglicht das Erkennen der dahinterliegenden persönlichen und zumeist nicht ausgesprochenen Gefühle und Bedürfnisse. Damit trägt sie dazu bei, dass Angriffe, Kritik und Vorwürfe nicht persönlich genommen werden, sondern sogar zur Reflexion verhelfen. Wer gewaltfrei kommuniziert, kann im Zuge seiner eigenen Ausdrucksweise auch andere dazu inspirieren, klar zu formulieren ohne manipulativ zu wirken oder Gesprächspartner:innen in einer subtilen Weise zu erpressen. Der gewaltfreie Kommunikationsstil ermöglicht daher eine integre Einflussnahme im Sinne der Unternehmung oder des Projektvorhabens und zeichnet sich durch ein Gespräch auf Augenhöhe auch zwischen Hierarchieebenen aus. Was bedeutet es konkret, gewaltfrei im Alltag zu kommunizieren?

Wie „funktioniert“ gewaltfreie Kommunikation?
Das Fundament der gewaltfreien Kommunikation (GFK) fußt auf zwei Hauptsäulen:

Was sich relativ kompakt auf den Punkt bringen lässt, ist in der Realität selten auch so einfach umzusetzen. Daher ist es — insbesondere auch für den Umgang mit dem Begriff ‚Bedürfnisse‘ – hilfreich, den Aufbau einer gewaltfreien Botschaft näher zu betrachten.
Alles fängt mit der Beobachtung an. Zusammen mit der Wertungsfreiheit ist die Beobachtung unser mächtigstes Werkzeug. Sie ist die Fähigkeit, wirkliche und nachhaltige Änderungen herbeizuführen, ohne aktiv einzugreifen. So ist die Benennung der Faktenlage ohne eine Interpretation und unter der Verwendung der „Ich“-Form eine gänzlich andere Ausgangslage für ein Projektmeeting als beispielsweise eine emotionsgeladene, verurteilende Anklage der beteiligten Projektteilnehmer durch den Fachbereichsleiter.
Die durch eine Kommunikation freigesetzte Information wird von uns verarbeitet und löst je nach Relevanz eine Reaktion in uns aus. Es ist diese wahrgenommene Relevanz, die unsere Gefühle steuert und eine Wertung in uns entstehen lässt. Es ist wichtig, Klarheit über diese treibende Kraft zu erlangen, um die Wahrnehmung und im zweiten Schritt Expression dieser Gefühle handhaben zu können. Hier lauert auch eine größere Problematik, denn Gefühle sind für uns nur schwer von Gedanken zu unterscheiden. Dabei ist ein Gefühl im Gegensatz zum Gedanken nie wertend. Es ist unser Urteil, welches den Gedanken als solchen zu entlarven hilft. Doch unser Verstand ist sehr kreativ und kann Gedanken hervorragend als Gefühle tarnen. Floskeln wie „ich habe das Gefühl, dass…“ geben uns einen Hinweis auf „DenkGefühle“, die in Wahrheit
Gedanken und keine Gefühle darstellen. Für eine erfolgreiche GFK ist es aber wichtig, die Gedanken und Gefühle sauber auseinander halten zu können, denn nur so können wir den nächsten Schritt der GFK erfolgreich meistern.

Vom Fundament zur Umsetzung
Durch die Beobachtung der Situation und die Identifikation unserer Gefühle gewinnen wir Klarheit bezüglich unserer Bedürfnisse. In diesem Zusammenhang ist es hilfreich sich vor Augen zu führen, dass all unsere Handlungen dem Ziel unterliegen, ein Bedürfnis zu erfüllen. Bedürfnisse korrespondieren mit unseren Gefühlen und sind abstrakter und positiver Natur. Während manche Bedürfnisse von Mensch zu Mensch variieren, teilen alle Menschen bestimmte Grundbedürfnisse, wie beispielsweise das Bedürfnis nach Nähe.
Die Bedürfnisbefriedigung bringt uns allerdings zu ihrer Schattenseite, der Strategie. Es ist das Mittel zum Zweck und darf für eine saubere, gewaltfreie Kommunikation eben nicht mit dem Bedürfnis an sich verwechselt oder vermischt werden. Strategien kann man daran erkennen, dass man sie beispielsweise tun, anfassen oder messen kann, während das Bedürfnis (bspw. nach Nähe) etwas Abstraktes bleibt.
Um das abstrakte, identifizierte Bedürfnis nun in die Realität zu bringen, haben wir die Möglichkeit, unseren Wunsch in Form einer Bitte zu äußern. Dies ist die finale Stufe der GFK. Das ausschlaggebende Merkmal der Bitte ist die Augenhöhe, auf der sie geäußert wird. Es ist diese Basis, die den Unterschied zwischen einer Bitte und einer Forderung ausmacht. Eine Forderung bringt nämlich immer, wenn auch nur sehr subtil, den Zwang sich ihr zu fügen. Es ist die Möglichkeit der problemlosen Ablehnung einer Bitte, die eine Kommunikation auf Augenhöhe erkennbar werden lässt.
Während wir jedes Bedürfnis eines Menschen verstehen können, müssen wir uns nicht zwingend damit einverstanden erklären. Das Verständnis korrespondiert daher mit den Bedürfnissen, wohingegen Einverständnis das Resultat einer Bitte darstellen kann. Hier können wir uns den Einfluss der zweiten Säule der GFK noch einmal verdeutlichen: Empathie. Es ist die empathische Haltung, die uns beispielsweise die Angst des Gegenübers verstehen lässt, aber uns nicht dazu zwingt mit ihm einverstanden zu sein.

Zusammenfassung und eine Übung zur GFK
Um uns in der GFK zu üben, hilft es zunächst, die vier Schritte und ihre potenziellen Fehldeutungen kompakt gegenüberzustellen:

Von der interpretationsfreien Beobachtung kommen wir am Gedanken vorbei zum Gefühl. Die Klarheit über unsere Gefühlslage zeigt uns unsere Bedürfnisse auf, die wir von ihrer Erfüllungsstrategie zu trennen vermögen und in Form einer Bitte anstelle einer Forderung umsetzen können.
Die Umsetzung kann beispielsweise mit der Technik des „Spiegelns“ ausprobiert und trainiert werden. Wir „spiegeln“ unserem Gegenüber, dass er oder sie verstanden worden ist. Im Rahmen dieser Feedback-Schleife, spiegeln wir in eigenen Worten das Gesagte dem „Sender“ wider. So kann ein einheitliches Verständnis einer Sachlage zwischen dem Sender und Empfänger einer Botschaft hergestellt werden und so eine zumeist sachlichere und wertungsfreie Ebene der Situation erreicht werden.
Self-Check:
Kleine Checkliste für den Alltag Gefühle und Bedürfnisse
Bedürfnisse sind das, was uns grundlegend wichtig ist. Werden unsere Bedürfnisse nicht erfüllt, so machen sie sich auf unterschiedlichen Ebenen bemerkbar:
Wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind, dann empfinden wir das als eher angenehm. Wir fühlen uns dann:
Wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann empfinden wir das als eher unangenehm. Wir fühlen uns dann:
Achtung: Verwechseln Sie Gefühle nicht mit Gedanken!
In unserer Alltagssprache behaupten wir oft zu fühlen, obwohl wir eigentlich beurteilen:
Weitere Beispiele für DenkGefühle:
Literaturhinweise:
Marshall B. Rosenberg
Andreas Basu & Liane Faust
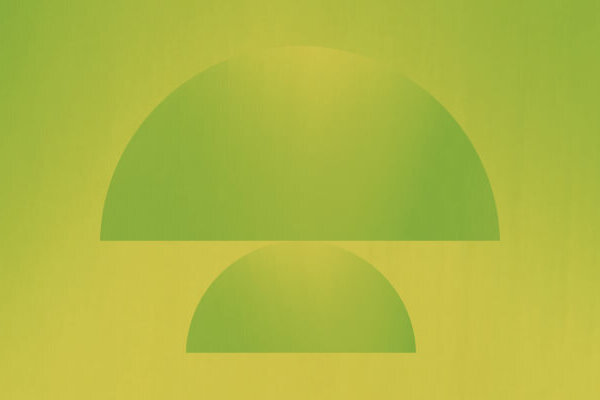
Achtsame Sprache schafft Klarheit ohne Verletzung und macht Konflikte lösbar. Sie stärkt Präsenz, Sicherheit und Kooperation – ein wirksames Führungsinstrument.
Mehr erfahrenDer Konflikt dient als Landkarte zu Bedürfnissen und Zielen der Mitglieder und führt zu neuen, haltbaren Vereinbarungen. Wir moderieren Konflikte – sowohl zwischen zwei Akteur:innen als auch im Team sowie zwischen Teams.
Mehr erfahren